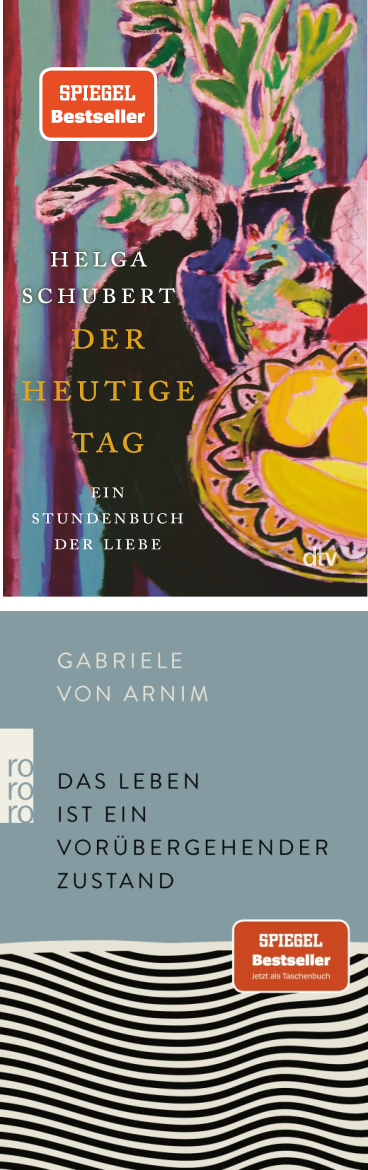Erinnerungsvorsorge
05.05.2025 — Susanne Wenger
Carte Blanche, Kolumne in «auguste», dem Magazin von Alzheimer Schweiz
Kürzlich hörte ich im Vintage-Radio einen Song aus meiner Jugend: «Lady in Black» von Uriah Heep, eine etwas simple, aber eingängige Rockhymne. Schon die ersten Töne versetzten mich in ein Schul-Skilager der späten Siebziger zurück. Sofort war alles wieder da: Das staubige Massenlager im Berner Oberland. Erdbeer-Rhabarber-Konfitüre, grosse Ruchbrot-Laibe und Kakao zum Frühstück. Skitage auf wunderbar viel Schnee, die Gruppen strikt nach Können getrennt. Am letzten Abend Disco, mit «Lady in Black» und anderen Hits. Die Lehrer massen doch tatsächlich mit dem Lineal nach, ob wir Teenies beim geschlossenen Tanzen genügend Abstand hielten.
Eindrücklich, wie Musik Erinnerungen wecken kann. Oder Emotionen. Oder Erinnerungen und Emotionen. Dies bei uns allen, ganz egal, ob wir musikalisch sind oder nicht. Und es funktioniert nachweislich auch bei einer Demenzerkrankung, bis in fortgeschrittene Stadien. Menschen mit Gedächtnisverlust erinnern sich kaum mehr an ihre Biografie, aber an Musikstücke – und über diese Brücke an Episoden ihres Lebens. Menschen, die ihre Sprache verloren haben, singen plötzlich Liedtexte mit. In sich versunkene Menschen leben durch ein vertrautes Musikstück auf, treten mit Angehörigen und Pflegepersonal in Verbindung. Lächeln, wissen wieder, wer sie waren und wer sie sind, sprechen kohärent – mindestens eine Weile lang.
Ein faszinierendes Phänomen, das Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler mit der einzigartigen Wirkung von Musik auf das Gehirn erklären. Sie ist dort breit und stark verankert. Beim Musikhören sind mehrere Bereiche des Hirns beteiligt, vom Gedächtnis über die Emotionen bis zum Bewegungszentrum. Dadurch gibt es mehr Möglichkeiten, die Effekte der Musik zu bewahren. Musik ist ein so kraftvoller Stimulus, dass sie Erinnerungen und Gefühle selbst dann zurückbringen kann, wenn unser Gehirn durch eine Erkrankung wie Demenz beschädigt ist.
Einige Pflegeinstitutionen in der Schweiz setzen personalisierte Playlisten in der Betreuung von Menschen mit Demenz ein, mit sehr guten Resultaten. Das Bestechende ist aber, dass die Musik ihre Superkraft jederzeit und an jedem Ort auf einfache Weise entfalten kann. Seit vor zwei Jahren die Demenz in meine Familie gekommen ist, haben wir das erlebt. Bedeutende Lieblingsstücke, gemeinsam angehört – und ein verwirrender Spitalaufenthalt wurde einen Nachmittag lang leicht. Herzhaft und vielstimmig gesungene Lieder während einer Autofahrt nach Italien an den gewohnten Ferienort – und die Erkrankung war weit weg.
Dass unsere Kognition, unsere Vergangenheit, unser Selbst wie ein Schatz in einem vertrauten Musikstück eingebettet sind und hervorgeholt werden können: Ich finde diesen Gedanken tröstlich. Mit der Musik, die uns durchs Leben begleitet, betreiben wir automatisch Erinnerungsvorsorge. Wir alle sollten aber auch früh genug mindestens fünf Musikstücke unseres Lebens notieren, riet mir einmal ein pensionierter Musiktherapeut, den ich als Journalistin porträtierte. Falls wir an Demenz erkrankten, könnten Angehörige die Liste zücken, meinte er. Ich bin dem Rat gefolgt, meine top Zwanzig sind in Arbeit. Der Skilager-Knüller «Lady in Black» ist nicht dabei. Dafür «Tant de belles Choses» von Françoise Hardy. Und was kommt auf Ihre Liste, liebe Leserin, lieber Leser?
/data/blog/2025/05/1024px-Wurlitzer_700_Jukebox_%2853998134164%29.jpg)
Kraftvoller Stimulus: Musik holt unsere Vergangenheit hervor. (Foto: Wikimedia Commons)
/data/blog/2024/09/Bildschirmfoto%202024-09-20%20um%2009.37.32.png)
/data/blog/2024/05/Cover_Gelesen_Own_your_Age.jpg)
/data/blog/2024/02/Bildschirmfoto%202024-02-26%20um%2018.53.20.png)